Die Elementare
- Festa
- Erschienen: November 2024
- 1
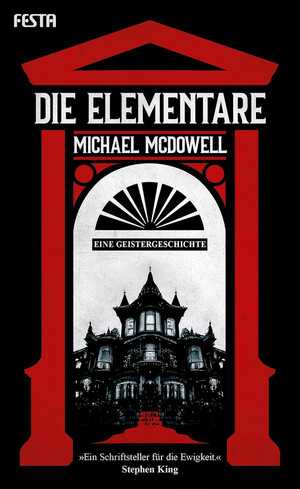
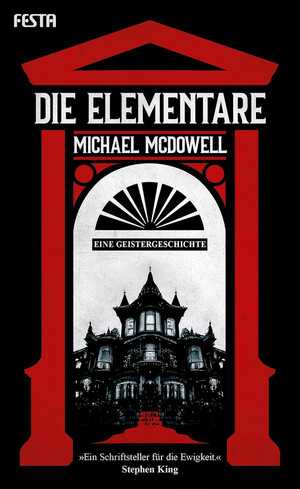
Das Böse unter der Südstaatensonne
In Mobile, einer Stadt im US-Staat Alabama, erliegt Marian, Matriarchin der altehrwürdigen (und reichen) Südstaatenfamilie Savage, ihrem Leiden. Sie hinterlässt vorwiegend mäßig trauernde Angehörige, denn sie war schon vor ihrer Krankheit eine kalte, unglückliche Frau. Zudem haben ihre Kinder Mary-Scot und Dauphin, dessen Gattin Leigh, Schwiegermutter „Big Barbara“ McCray, deren Sohn Luker und Enkeltochter India genug mit eigenen Familienproblemen zu tun.
Dennoch begibt man sich für einige Sommerwochen nach Beldame: Am Strand des Golfs von Mexiko ließ ein Vorfahre 1875 drei identische Strandvillen errichten, die mehr als genug Raum für alle Savages und McCrays bieten. Eines der großen Häuser steht seit Jahrzehnten leer und wird allmählich unter einer Sanddüne begraben; ein Prozess, der nach Ansicht der Familie nicht schnell genug vollendet sein kann.
Dieses dritte Gebäude gilt als verflucht. Hier gehen offenbar Geister um, was die Familie entschlossen ausblendet. Das Haus wird ignoriert und gemieden. Die 13-jährige India kann ihre Neugier allerdings nicht zügeln und steigt in das Haus ein. Auf diese Weise weckt sie ungewollt, was dort meist geschlummert hat, aber nun hellwach über die unglücklichen Feriengäste kommt ...
In der Hitze der Nacht brütet das Böse
Eigentlich jagen uns Geister kalte Schauer über den Rücken. Schließlich treten sie traditionsbewusst des Mitternachts auf, wenn es auch im Sommer recht kühl werden kann. Man trifft sie außerdem in eisigen Winternächten auf Friedhöfen, in einsamen Häusern und an ähnlichen Orten, die schon tagsüber unheimlich wirken. Jetzt konfrontiert uns Michael McDowell mit einem Grusel, der hohe Temperaturen vorzieht - notgedrungen, denn er treibt sein Unwesen im US-amerikanischen Süden, wo der Äquator quasi in Sichtweite liegt. Dies sorgt für milde ‚Winter‘, aber vor allem für lange, wahrlich heiße Sommer, in denen die Sonne den Himmel tagsüber nicht verlässt. Hinzu kommt eine hohe Luftfeuchtigkeit, was monumentale Schweißausbrüche garantiert.
Wer wie dieser Rezensent die Hitze als persönlichen Feind betrachtet, weiß um die Folgen: Hitze zermürbt körperlich und geistig und sorgt dafür, dass sonst wirksame Schutzfilter versagen. Selbstkontrolle und Rücksicht im Umgang mit den Nächsten leiden darunter, wenn ohnehin aufgekochte Emotionen sich ihren Weg bahnen. Wer sich dem entziehen kann, ist im Vorteil, denn aus dem Gleichgewicht gebrachte Menschen sind leichte Opfer.
Sie trifft es umso härter, wenn ihnen Phantome im Nacken sitzen, die sich ohnehin durch Unbarmherzigkeit und hartnäckiges Verfolgertum hervortun. Zudem suchen keineswegs simple Gespenster Beldame heim. McDowell entwirft eine Evolution, die nicht den Menschen allein die Krone der Schöpfung tragen lässt. Er teilt sich die Welt mit ähnlich intelligenten, aber gefährlichen Entitäten, die keinen festen Körper besitzen. Sie können sich in unterschiedlichen Gestalten manifestieren und sich deshalb schwer oder zu spät zu erkennen.
Tödliches Spiel ohne Regeln
Diese Entitäten (oder „Elementare“, wie McDowell sie nennt) sind nicht unbedingt gefährlich, sondern in erster Linie unberechenbar. Obwohl sie in menschliche Gestalten schlüpfen, werden die Elementare von Beldame nicht durch gespenstertypische Absichten getrieben. Also wollen sie durch ihr Spuken nicht zu Lebzeiten Unbewältigtes zu Ende bringen, um dadurch Erlösung zu finden. Ebensowenig ist die Rache an Bösewichten, denen sie ihren Tod verdanken, das Motiv. Sie sind, wie sie sind, und in diesem Fall aus menschlicher Sicht böse.
Die einzige Person, die das erkennt, ist Odessa Red, das schwarze Hausmädchen. Sie ist ‚abergläubisch‘, wodurch sie anders als die Savages und McCrays immerhin eine Vorstellung davon hat, was durch Beldame geistert. Allerdings wurzelt dieses Wissen nicht tief genug, was verhängnisvolle Konsequenzen nach sich zieht. Odessa versucht es ihren ratlosen Gefährt/inn/en zu erklären, als diese sie um Rat bedrängen; schließlich ist sie schwarz und sollte sich deshalb mit Südstaaten-Spuk auskennen: Der gefilterte, aber nie bewältigte Rassismus der US-Südstaaten ist auch den plakativ toleranten Savages und McCrays in Fleisch und Blut übergegangen.
McDowell erweist sich als Meister des „Southern Gothic“, jenes Horrors, der die Hitze der Kälte vorzieht und sich nicht an die nächtliche Dunkelheit gebunden fühlt. Die Elementare von Beldame sind auch deshalb so gefährlich, weil sie jederzeit, also auch im hellen Sonnenschein, in Erscheinung treten können. Ihnen hilft die Tatsache, dass außer Odessa niemand an sie glauben mag; dies wider besseres Wissen, denn die meisten Mitglieder der beiden Familien haben frühere Heimsuchungen erlebt, aber hartnäckig verdrängt: Wer sich in Beldame aufhält, würdigt das im Sand versinkende dritte Haus traditionell keines Blickes.
Modern im Denken und deshalb hilflos
Ignoranz mag die weiße Südstaaten-Elite über ihre trübe Historie hinwegtragen. Die Elementare scheren sich nicht darum. Sie ignorieren die hilflosen Ablenkungsmanöver ihrer Opfer, die sich ihnen stattdessen ausliefern, denn diese Wesen können Menschenhirne manipulieren. Zu spät erkennen die Savages und McCrays, was in Beldame geschieht. Da ist die Falle längst zugeschnappt.
Die Intensität dieser Geschichte teilt sich uns nicht nur aufgrund der geschickt und nur selten eingesetzten Elementare mit. McDowell hat ein gutes Gespür für Timing und Spannung. Er zieht die Schraube langsam, aber stetig an und sorgt dafür, dass sich das Grauen allmählich in die Handlung drängt, bis es diese übernimmt.
Parallel dazu gelingt McDowell ein weiteres, beachtliches Kunststück: Er lockt Personen nach Beldame, die wir nicht unbedingt lieben. Dennoch liegen sie uns am Herzen, denn der Autor hat sich viel Mühe mit der Schaffung von Charakteren gegeben, die nicht glatt und simpel, sondern menschlich sind, d. h. positive wie negative Züge realitätsnah widerspiegeln.
Familie und Geister: Schrecken im Wetteifer
Dabei bedient McDowell gekonnt bekannte Südstaaten-Redneck-Klischees, die er gleichzeitig konterkariert. Die Savages und die McCrays sind schwach, aber nicht böse. Der Autor stellt uns Individuen mit Ecken und Kanten vor. Big Barbara ist nicht (nur) eine dumme, laute Südstaatenmatrone, sondern eine warmherzige Frau mit Ehe- und Alkoholproblemen, ihr Sohn Luker ein politisch unkorrekter, aber liebevoller Vater. Tochter India ist altklug, weiß jedoch um die Qualitäten ihres Vaters. Haushälterin Odessa muss nicht demonstrativ das historische Kreuz des Südens vor sich hertragen. Sie weiß sehr wohl, wo sie sich innerhalb der Savage/McCray-Sippe positionieren will. McDowell sorgt für Ambivalenz. ‚Echte‘ Schurken sind selten; einer ist Big Barbaras korrupter und kaltherziger Gatte, den der Verfasser aus der Versenkung holt, als es darum geht, dem finalen Konflikt einen Auslöser zu schaffen.
Zum ‚gotischen‘ Charme trägt ein Erzählstil bei, der sich scheinbar dokumentarisch gibt, aber die Leser immer wieder mit bizarren Einschüben konfrontiert. Schon die feierliche Beerdigung von Marian Savage nimmt eine unerwartete Wendung, als die Familie der Leiche ein Messer ins Herz sticht: Dies ist zur Tradition geworden, seit vor langen Jahren eine junge Mutter in ihrer Gruft erwachte und elend starb - dies aber erst, nachdem sie ihr totes Baby gefressen hatte! Solche Stiche stören allerliebst die erstickende Südstaaten-Idylle, die sich über die Gruppe zu legen und auch die Leser zu erfassen droht. Stört uns der Autor nicht mit einer grotesken Anekdote auf, erzielen drastische ‚Ausrutscher‘ dieselbe Wirkung: „In den Trümmern des dritten Hauses hatte man nicht einmal genug sterbliche Überreste gefunden, um sie auf einen spitzen Stock zu spießen“ lautet auf Seite 399 eine dieser genialen Frivolitäten.
Michael McDowell schrieb in seinem kurzen Leben, das krankheitsbedingt nur von 1950 bis 1999 währte, viele Romane. Keineswegs hat er ausschließlich den US-Süden als Kulisse genutzt, und tat er es, hatte er nicht immer eine so glückliche Schreibhand wie in „Die Elementare“. Sein zwei Jahre später veröffentlichtes, von der Kritik ebenfalls als Klassiker gefeiertes, mehr als 1000-seitiges „Blackwater“-Epos (hierzulande zuletzt in sechs Bänden erschienen) kann da (jedenfalls nach Ansicht dieses Rezensenten) nicht mithalten. Zu breit und geradezu geschwätzig greift McDowell auf Südstaaten-Motive zurück, die er in „Die Elementare“ diszipliniert und effektvoll im Rahmen einer ebenso erschreckenden wie faszinierenden Story einsetzt.
Fazit:
Dieser hochgelobte Klassiker des literarischen Schreckens verdient seinen Lorbeerkranz tatsächlich. Story, Figurenzeichnung, Erzählstil - Der Autor balanciert mit vielen Bällen, die er sicher in der Luft hält: ein rundum unterhaltsames Meisterwerk!

Michael McDowell, Festa


Deine Meinung zu »Die Elementare«
Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer und respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Bitte Spoiler zum Inhalt vermeiden oder zumindest als solche deutlich in Deinem Kommentar kennzeichnen. Vielen Dank!